Neue Bücher
NEU: Neue Bücher verschicken wir jetzt versandkostenfrei innerhalb Deutschlands!
Neben den hier gelisteten Titeln können wir zur Zeit die Bücher der folgenden Verlage innert weniger Tage besorgen: Assoziation A, Bahoe, Buchmacherei, ça ira, Edition Nautilus, Edition Tiamat, ID-Verlag, Karin Kramer, Konkursbuch, Laika, Neue Kritik, Offizin, Papyrossa, Schmetterling, Stroemfeld, Unrast, Verbrecher und viele andere.
Die hier gelisteten Titel sind in der Regel an Lager und können sofort verschickt werden. Wir haben ausserdem HIER ein gutes Sortiment radikaler Literatur auf Englisch.
Updates auf twitter gibt's HIER.

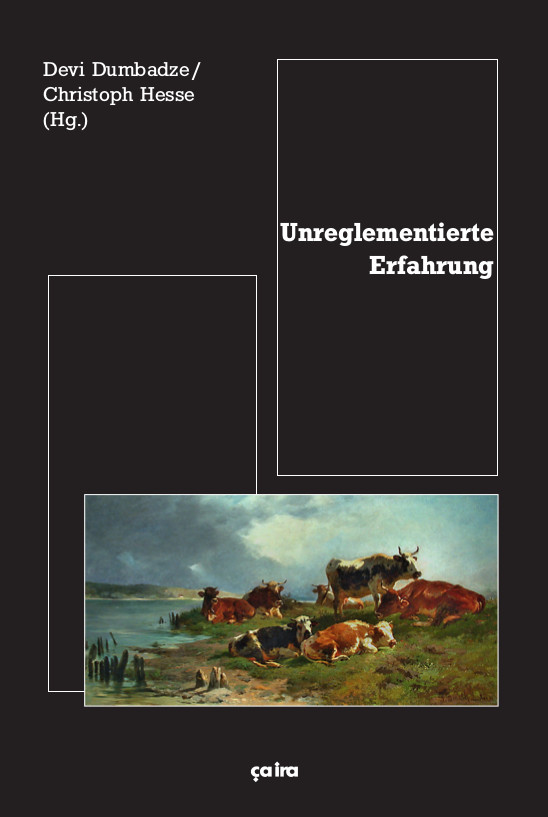
Es ist, als ob man vergebens aus nächster Nähe zu betrachten suchte, was in weitester Ferne liegt – und dennoch nur scheinbar ein Jenseitiges ist. Etwas unreglementiert erfahren: ist das überhaupt möglich? Die in diesem Band versammelten Beiträge widmen sich der Bestimmung eines Begriffs, der in der kritischen Theorie Adornos einen zentralen, wenngleich nie ausdrücklich benannten Platz einnimmt. In der zahlreich vorhandenen Literatur zu Adorno wird unreglementierte Erfahrung, wenn überhaupt, als ein nur subjektives Phänomen oder gar als ein dem wissenschaftlichen Objektivismus entgegengesetzter Ausdruck individuellen Leids aufgefaßt. Wie hier gezeigt werden soll, geht es allerdings bei der unreglementierten Erfahrung ums Ganze, um nichts weniger als die Möglichkeit von Emanzipation schlechthin. Inhalt: Devi Dumbadze, Christoph Hesse: Einleitung Gerhard Scheit: Erfahrung und jüngstes Gericht. Eine Anmerkung zum verborgenen Freiheitsbegriff der Kritischen Theorie Dirk Braunstein: Die Erfahrung der Gesellschaft. Grundsätzliches zur philosophischen Erkenntnis Simon Duckheim: Alles ganz anders. Adornos Utopie der Erkenntnis am Beispiel Prousts Devi Dumbadze: ”Religion, IST“. Ideologie und unreglementierte Erfahrung Isabelle Klasen: ”Erfahrung wider das Ich“. Überlegungen zu einem Schönen nach Adorno Irene Lehmann: Die möglichen Unendlichkeiten des Unverständlichen und die Formen der Kritik. Luigi Nono und das engagierte Kunstwerk Christoph Hesse: Virtuelle Erfahrung Fabian Kettner: Eine nutzlose Erfahrung. Der Tod als Instanz unreglementierter Erfahrung Die Autoren
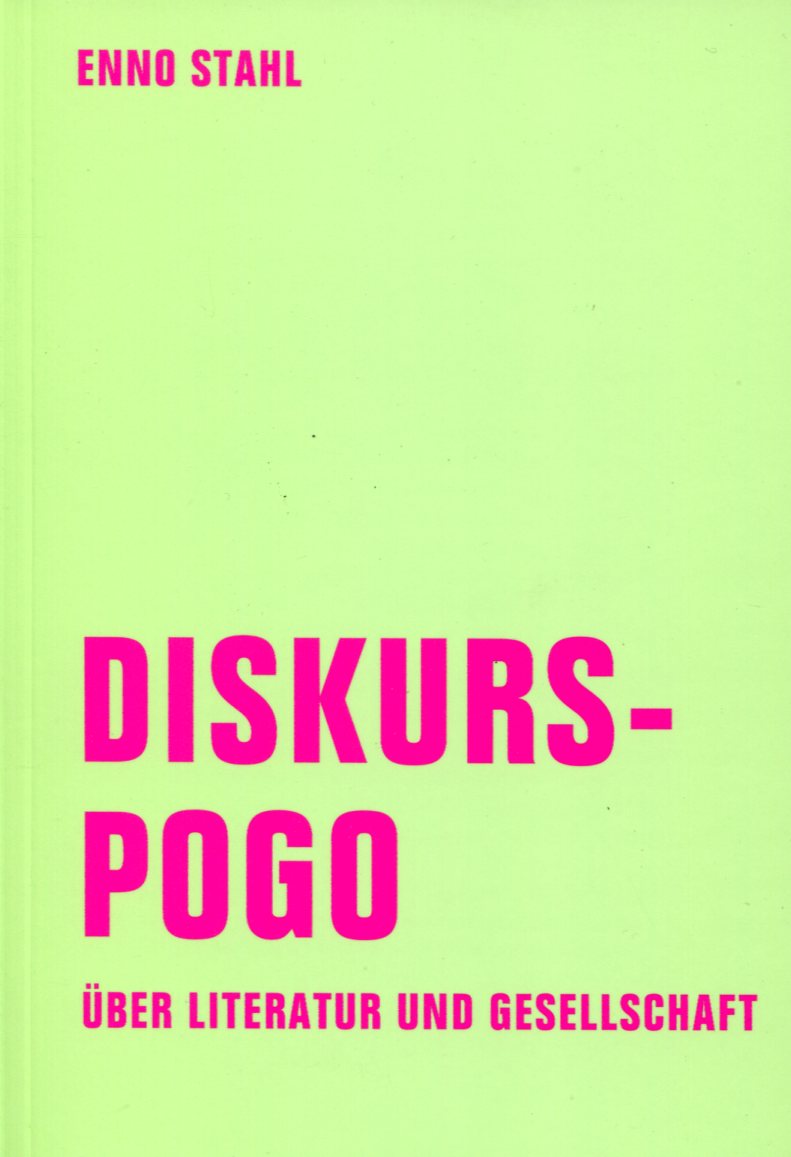
Ladenexemplar mit Lagerspuren! Warum ist realistische Literatur oft nur pseudorealistisch und die sogenannte Popliteratur lediglich ein erfolgreiches Marketingprodukt? In drei Kapiteln analysiert Enno Stahl – teils kritisch und konfrontativ, teils verwundert - die aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen, die Politik unserer Zeit und die (fehlende) Auseinandersetzung damit in der deutschen Gegenwartsliteratur. Er untersucht u. a. Christian Kracht, Ernst-Wilhelm Händler und Juli Zeh mit ideologiekritischer Verve, analysiert die Social-Beat-Bewegung, Poetry-Slams und die Anfänge des deutschen Punk im Ratinger Hof in Düsseldorf. Außerdem geht es um Ausbeutung in der heutigen Arbeitswelt, von der katastrophalen Lohnsituation bis hin zum Schlafentzug. Diese wird in der Gegenwartsliteratur kaum thematisiert, da Erwerbsarbeit hier keine Rolle zu spielen scheint. Demgegenüber entwickelt Stahl eine Programmatik, in der er zeitgenössisches literarisches Engagement fordert, eine Literatur, die sich den gesellschaftlichen Aporien stellt. InhaltVorwortZur Methode: WertungsdispositiveSOZIALE LITERATURDer sozial-realistische RomanLiteratur in Zeiten der Umverteilung"Wir schlafen nicht." New Economy und LiteraturKneipen-Jobber und KulturschaffendeUrbane Szenerien in der zeitgenössischen LyrikRisikogesellschaften. Lyrik und ihre Bilder vom SozialenRealismus und literarische AnalyseII POP, PUNK UND TERRORPopliteratur – Phänomen oder Phantasma?Trash, Social Beat und Slam-Poetry. Eine BegriffsentwirrungPopliteratur – eine fragwürdige KategorieRatinger Hof – Thomas Kling und die Düsseldorfer PunkszeneLiteratur und TerrorIII KULTUR UND GESELLSCHAFTAnti-(Schein-)Affirmation.Notiz zu einer zeitgenössischen KulturkritikBolz, Hörisch, Kittler und Winkels tanzen Pogo – erst im Ratinger Hof, dann deutschlandweitWenn ein jeder zum Krämer wird. Über das PrekariatUtopie des RespektsANHANGQuellennachweiseAnmerkungenNamensregister
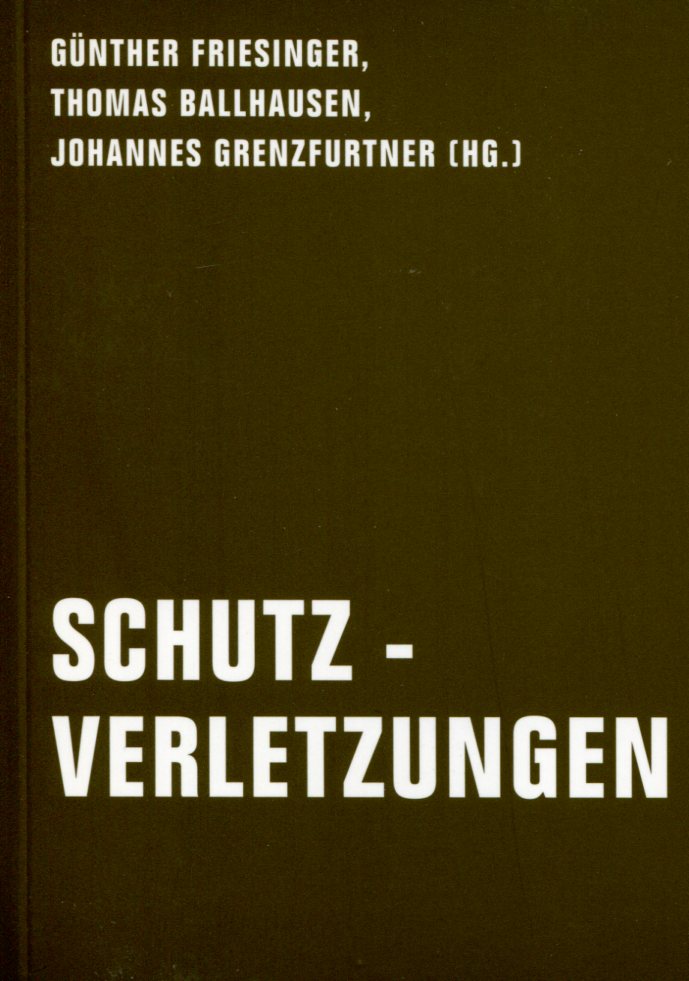
Eigentlich Neuware, stand aber länger in unserm Laden und hat deshalb leichte Gebrauchs-/Lagerspuren Die möglichen Verbindungen von „Medien“ und „Gewalt“ sind in der wissenschaftlichen Welt schon unter den verschiedensten Vorzeichen diskutiert und behandelt worden. Ziel der vorliegenden Publikation ist es, entgegen der weitverbreiteten medienpädagogischen Fragestellungen zu versuchen, sich mit der Medialisierung von Gewalt und der Übernahme der (realen) Gewalt in die Welt der Medien sowie der Frage nach der (mitunter ebenfalls medialen) Legitimierung der Darstellung von Gewalt in den Medien auseinanderzusetzen und zu neuen Lösungsansätzen zu finden.
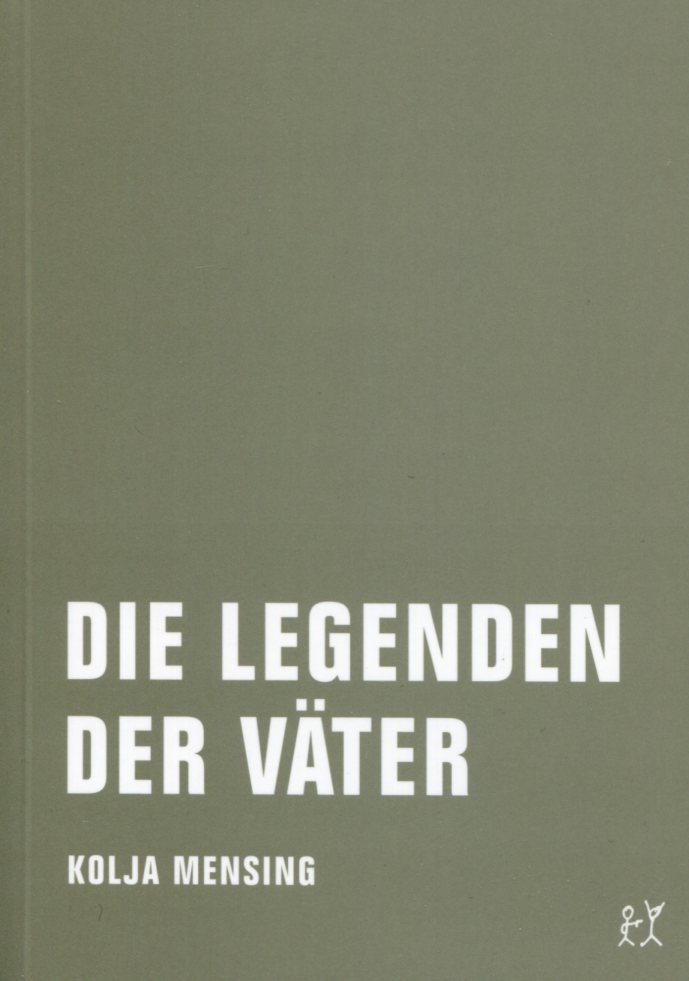
1946 wird ein Kind im Nordwesten Deutschlands geboren. Der Vater ist Pole, Soldat der polnischen Besatzungsarmee, die in der britischen Besatzungszone agiert, die Mutter Deutsche. Die Liebe scheitert, der Soldat geht zurück nach Polen, und das Kind – ein Sohn – wächst ohne Vater auf. Erst viele Jahre später gibt es einen Kontakt. Und noch einmal viele Jahre später begibt sich Kolja Mensing, der Enkel, auf eine Spurensuche in Deutschland und Polen. Er entdeckt, dass Familiengeschichten nie so eindeutig sind, wie sie erzählt werden, und dass Krieg und Besatzungszeit auch seine Generation noch prägen. Das Buch ist eine vollständig überarbeitete Neuausgabe mit einem aktuellen Nachwort des Autors. Kolja Mensing beleuchtet darin - 70 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs - die historischen Umstände der polnischen Besatzungszone, die zwischen 1945 und 1947 im nördlichen Emsland und rund um Oldenburg und Leer existierte und bislang nur wenig bekannt ist.
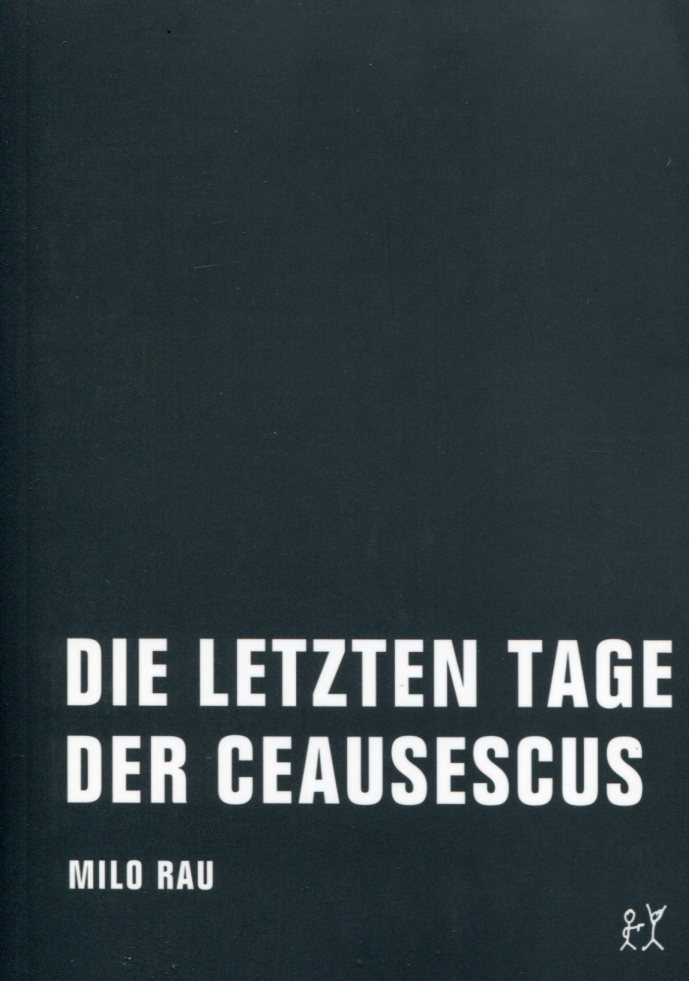
Die Bilder der Aburteilung und Hinrichtung der Ceausescus am 25. Dezember 1989 gruben sich als düsteres Negativ der samtenen Revolutionen tief ins kollektive Unbewusste mehrerer Generationen westlicher Fernsehzuschauer. Das International Institute of Political Murder (IIPM) nahm dieses Ereignis zum Anlass umfangreicher Recherchen vor Ort. Die mit dem General, der die Ceausescus verriet, dem Soldaten, der sie erschoss und vielen weiteren Zeitzeugen geführten Gespräche ergeben ein Panorama des Untergangs eines der zugleich absurdesten und totalitärsten Regimes der Weltgeschichte. Die daraus entstandene Re-Inszenierung dieses letzten europäischen Schauprozesses wurde im Rahmen der rumänischen Voraufführungen kontrovers diskutiert.„Die letzten Tage der Ceausescus“ versammelt neben dem Prozesstransskript und den Gesprächsprotokollen zur rumänischen Revolution eine Fülle an Dokumenten aus Recherche und Inszenierung. Der reich bebilderte Band wird komplettiert von Theorie- und Sachbeiträgen von Friedrich Kittler, Andrei Ujica, Heinz Bude, Gerd Koenen, Ion Iliescu u.a. Das International Institute of Political Murder (IIPM; www.international-institute.de) wurde im Jahr 2007 mit Sitz in Berlin und Zürich gegründet, um den Austausch zwischen Theater, bildender Kunst, Film und Forschung auf dem Gebiet des Reenactments – der Re-Inszenierung geschichtlicher Ereignisse – zu intensivieren und theoretisch zu reflektieren.

(ursprünglich Neuware, aber mit geringfügigen Lagerspuren) Filit 14, ediert und eingeleitet von Eva Orbanz Klaus Wildenhahn ist Dokumentarfilmer und Filmproduzent. Über Jahre hat er für den NDR gearbeitet, Filme gedreht über den »sogenannten Alltag«, wie er einmal geschrieben hat, den »Zustand nach der Sensation, das Befinden der sogenannten kleinen Leute, nachdem der Flügelschlag der Geschichte vorbeigerauscht ist«. Immer wieder hat er sich auch programmatisch zu seinem Metier geäußert. Souverän seiner Filme sollten die Menschen sein. Der Filmmacher tritt in einen Dialog mit ihnen, die Gefilmten nehmen den Filmenden mit, sie schaffen die Szene. Neben dem Filmen hat Wildenhahn geschrieben. Mit 17 Jahren, sagt er, habe er damit begonnen, zunächst, »um der Enge« im Nachkriegsdeutschland zu entkommen, später getrieben von dem Wunsch, »das Früher wachzuhalten und aufzusuchen«. Entstanden sind Gedichte und Prosa, auch Streitschriften. Notiert unterwegs, in Cafés und Kneipen, auf Reisen, an Drehorten. In die lyrischen Texte fließen Zeit, Ort und gegenwärtige Stimmungen ein – man hört die Musik, man fühlt den Regen, man spürt die Kälte. Und sieht die Menschen und den, der sie betrachtet. »Abendbier in flacher Gegend« versammelt neue und alte Texte von Klaus Wildenhahn, der 2015 seinen 85. Geburtstag feiert. Das Buch erscheint im Rahmen der Filmliteratur-Reihe »Filit«. Sie wird von Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen herausgegeben und entsteht in Zusammenarbeit der Deutschen Kinemathek mit dem Verbrecher Verlag.
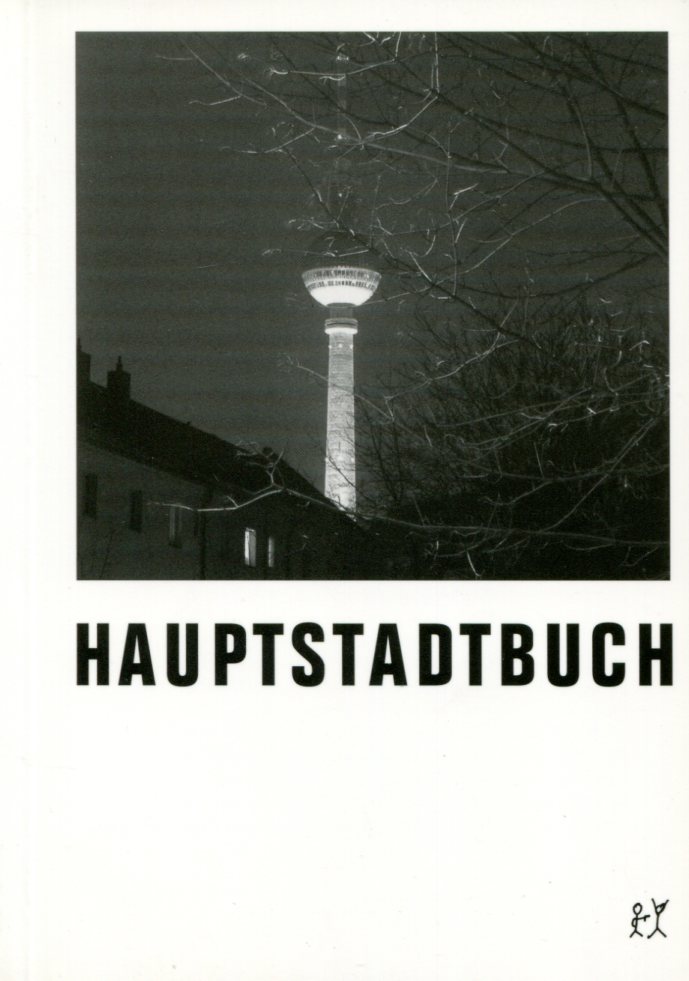
ANtiquarisch in gutem Zst. Seit dem Fall der Mauer ist Berlin wieder Hauptstadt, doch bleibt die bange Frage: wird diese Stadt den Anforderungen an eine Hauptstadt überhaupt gerecht? Zwar verteidigen die Senatoren und Bürgermeister seit Jahren verzweifelt den Anspruch, wenn schon nicht New York und Paris, so doch Moskau und London als die „Szene“-Hauptstadt überholt zu haben. Andererseits pflegt man in Berlin das größte Sozialamt Europas und die merkwürdigsten Provinzialismen, setzt obskure Stadtteilentwürfe gegen gewachsene Strukturen. Inwieweit ist Berlin eine Hauptstadt? Wie lebt es sich in ihr? Dieser Frage gehen die Beiträge dieses Buches nach. Texte und Bilder von Barbara Bollwahn, Peter O. Chotjewitz, Manja Dornberger, Tanja Dückers, Nils Folckers, Oliver Grajewski, Sarah Herke, Martin Hiebl, Meike Jansen, Barbara Kalender, Bayram Karamollaoglu, Jürgen Kiontke, Susanne Klingner, Knud Kohr, Maximilian König, Kirsten Küppers, Philip Meinhold, Kolja Mensing, Ralf Niemczyk, OL, Sven Regener, Jana Schmidt, Sarah Schmidt, Jörg Schröder, David Wagner, Ambros Waibel, Florian Werner, Stefan Wirner und Stephanie Wurster
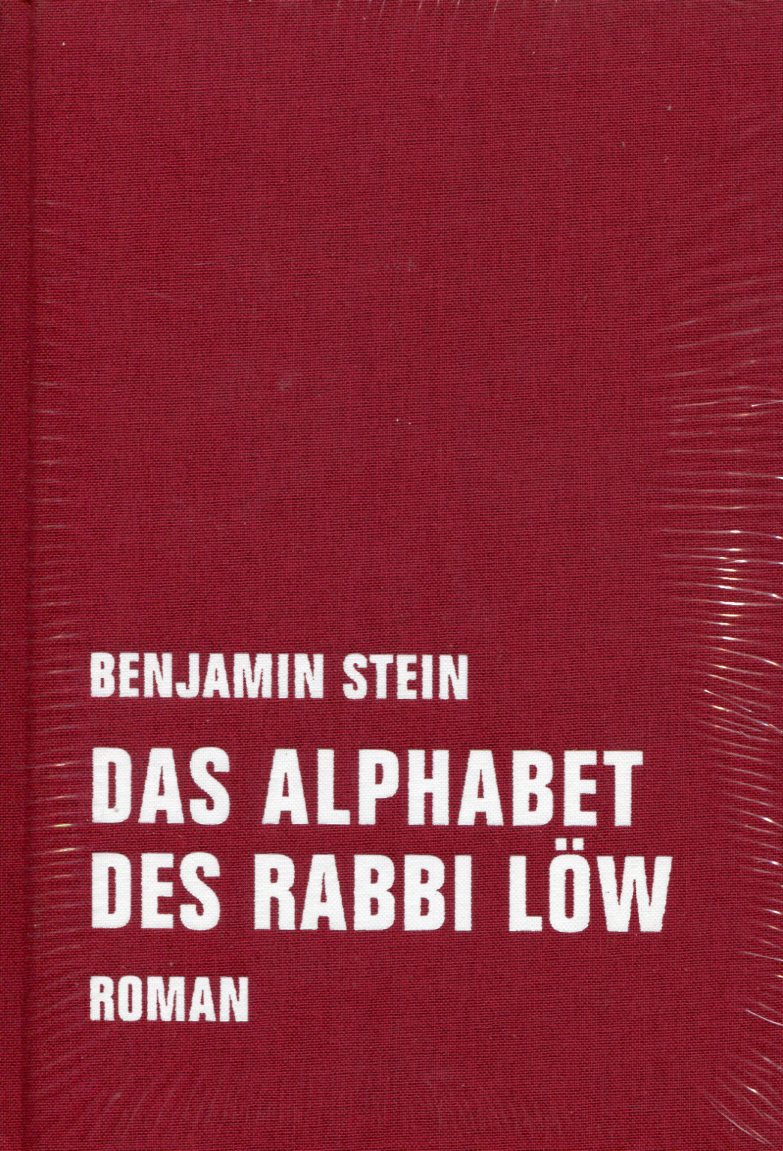
Ein junger Mann trifft in seinem Stammlokal in Berlin-Kreuzberg einen Unbekannten, der sich ihm als ungewöhnliches Geburtstagsgeschenk für seine Frau aufdrängt: Jeden Dienstagabend wird er bei ihnen vorbeikommen und ihnen eine Geschichte in Fortsetzungen erzählen – Bezahlung: eine Flasche Wodka. Mit seinen wundersamen Geschichten entführt Jacoby seine Zuhörer von Berlin nach Prag und Budapest und durch das gesamte 20. Jahrhundert. In ihnen geht es um himmlische Paläste und unterirdische Städte, um Engel und Propheten, es wird geliebt, gehasst, verflucht, gestorben und gemordet. Während die Männer noch nach Liebe oder Erkenntnis suchen, haben die Frauen bereits gewählt – und bleiben am Ende doch allein. Und im Hintergrund zieht der Hohe Rabbi Löw von Prag samt Golem die Strippen und führt Regie. Benjamin Stein verknüpft geschickt die einzelnen Stränge der verzweigten Geschichte und führt uns ein in die Welt des Erzählens und der Buchstaben, auf denen die Welt beruht – bis Wirklichkeit und Erzählung nicht mehr zu unterscheiden sind. Mit »Das Alphabet des Rabbi Löw« liegt jetzt eine Komplettüberarbeitung des Debütromans von Benjamin Stein vor. Die Sprache ist dichter geworden, die Handlung klarer – ein großartiges Leseerlebnis.
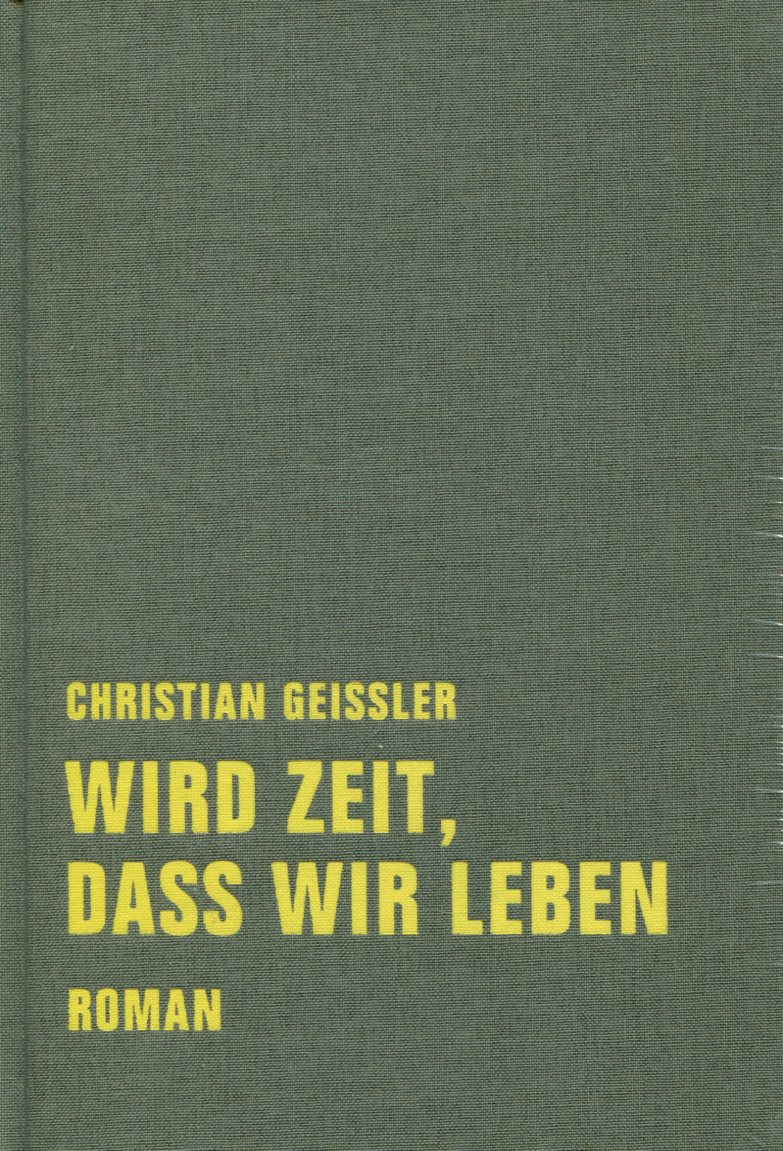
In »Wird Zeit, dass wir leben« erzählt Christian Geissler mit »balladenhaft-lyrischer Präzision« (Heinrich Böll) vom Widerstand der Kommunisten gegen die Nazis in Hamburg. Als ob er mitten im Geschehen steckt, begleitet er seine Figuren durch die Kämpfe vor und nach 1933. Er erzählt von Gewalt von oben und Gegenwehr von unten, vom Spannungsverhältnis zwischen Kollektiv und Individuum, zwischen Disziplin und Eigensinn - und zieht den Leser in die immer noch aktuellen Debatten mit hinein. Schlosser ist Funktionär der KPD. Bis zu seiner Verhaftung bremst er den Eifer der Genossen im Kampf gegen die Nazis, verweigert die Waffen und pocht auf Disziplin. Die Genossen von der Basis aber wollen kämpfen. Kämpfen bedeutet für sie Lust und Leben. Vor allem für Karo, aber auch für Leo, der noch 1930 zur Polizei geht, aber später begreift, dass er auf der falschen Seite steht. Geisslers Roman basiert auf einer wahren Geschichte: Das Vorbild für Leo war der Hamburger Polizist Bruno Meyer, der Anfang 1935 die Widerstandskämpfer Fiete Schulze und Etkar André aus dem Gefängnis befreien wollte. Detlef Grumbach recherchierte umfassend und erzählt in seinem Nachwort erstmals vom Schicksal Bruno Meyers. Das Buch ist der Auftakt einer Christian-Geissler-Werkschau im Verbrecher Verlag.
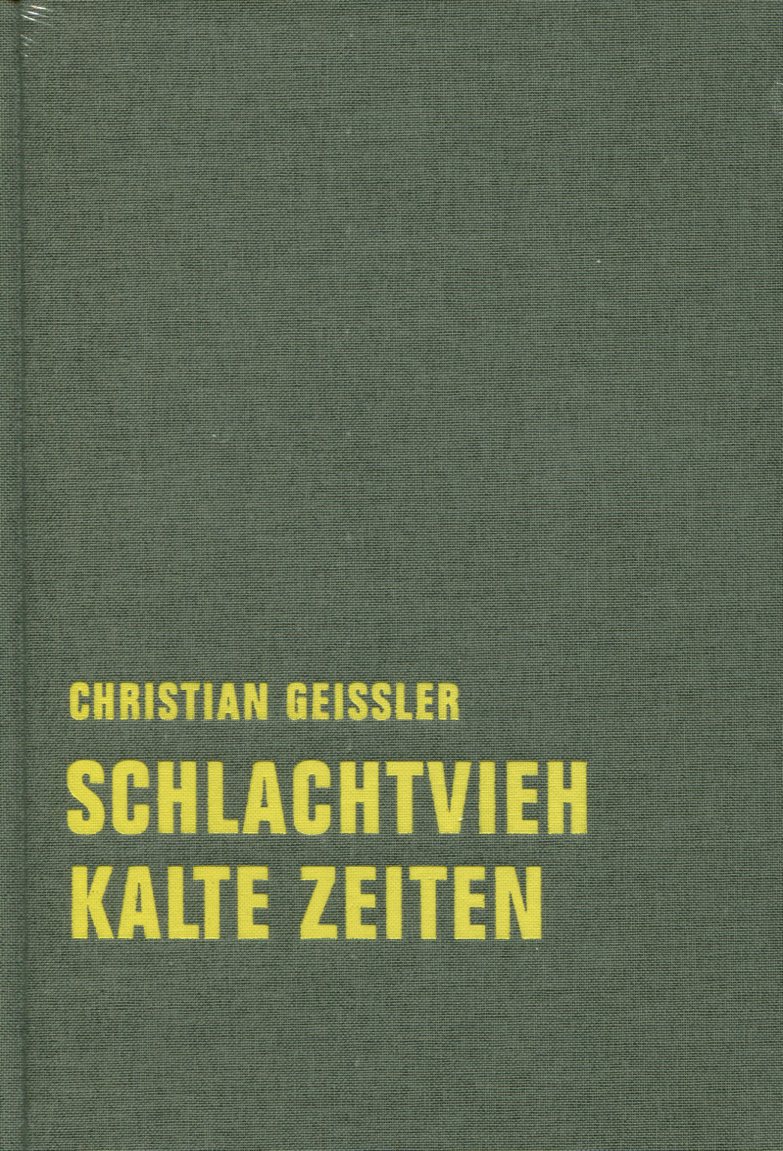
Drehbuch und Roman, mit einem Nachwort von Michael Töteberg "Ich halte ‚Kalte Zeiten’ für ein Meisterwerk in der literarischen Auseinandersetzung mit der industriellen Arbeitswelt." Max von der Grün Freitag in Hamburg-Wilhelmsburg: Der junge Bauarbeiter Jan Ahlers bekommt seine Lohntüte, legt eine Sonderschicht ein und träumt von einem größeren Auto. Seine Frau Renate kümmert sich währenddessen um den Haushalt, später verliert sie sich beim Stadtbummel in den Kaufangeboten. Ein Kind wäre schön, aber das kostet. Beide sind gefangen in Konsumwünschen und verraten dabei ihre Liebe und sich selbst – das ist der Roman „Kalte Zeiten“. Reisende in einem Zug. Einige Abteile sind versperrt, die Fenster lassen sich nicht öffnen, dann ist die Fernsprechverbindung unterbrochen, und die Fahrgäste hören unheimliche Durchsagen. Einige fragen sich, was los ist, diskutieren und wollen der Sache auf den Grund gehen. Das Schreibabteilmädchen versucht sogar, die Notbremse zu ziehen und wird festgesetzt. Die Mehrheit aber will die Reise einfach fortsetzen, mit dem Segen eines Kirchenmannes – das ist das Drehbuch „Schlachtvieh“. Als der Brecht-Schüler Egon Monk 1960 Leiter der NDR-Fernsehspielabteilung wurde, begann er mit einer Umsetzung von Christian Geisslers erstem Roman „Anfrage“. Darauf folgten bis Mitte der 70er-Jahre weitere Fernseharbeiten Geisslers, die großen Einfluss auf seine spätere Prosa hatten. Unter dem Eindruck der Wiederbewaffnung Deutschlands schrieb Geissler 1963 das Drehbuch „Schlachtvieh“, ein Lehrstück. Warum wehrt sich kaum jemand, wenn die eigenen Interessen mit Füßen getreten werden? Auf der Suche nach einer Antwort entstand das Fernsehspiel „Wilhelmsburger Freitag“ (1964), die Vorlage für den Roman „Kalte Zeiten“. Michael Töteberg beleuchtet in seinem Nachwort erstmals das Schaffen Christian Geisslers als Autor von Fernsehspielen und Dokumentarfilmen.

Herausgegeben von Manja Präkels und Markus Liske Es ist nicht möglich, Leben und Werk Erich Mühsams zu trennen. Er war Bohemien, Dichter, Anarchist, Humorist, politischer Publizist, Dramatiker, bisexueller Erotomane, Revolutionär, selbst in größter Not unbeirrbarer Menschenfreund und schließlich eines der ersten prominenten Opfer der Nazis. 1933 wurde er noch in der Nacht des Reichstagsbrandes verhaftet und nach monatelanger Folter im KZ Oranienburg ermordet. Aufgabe dieses Lesebuchs soll es sein, Mühsams lebenslangen Kampf »für Gerechtigkeit und Kultur« mit Texten aus seinem reichhaltigen Werk nachzuerzählen, die bis heute nichts an ihrer politischen Aktualität verloren haben. Neben einigen Mühsam-Klassikern enthält diese Sammlung auch bislang unveröffentlichte Gedichte, Auszüge aus längeren Werken, ausgewählte Briefe und die Beschreibung seiner letzten Tage aus der Feder seiner Frau Zenzl.
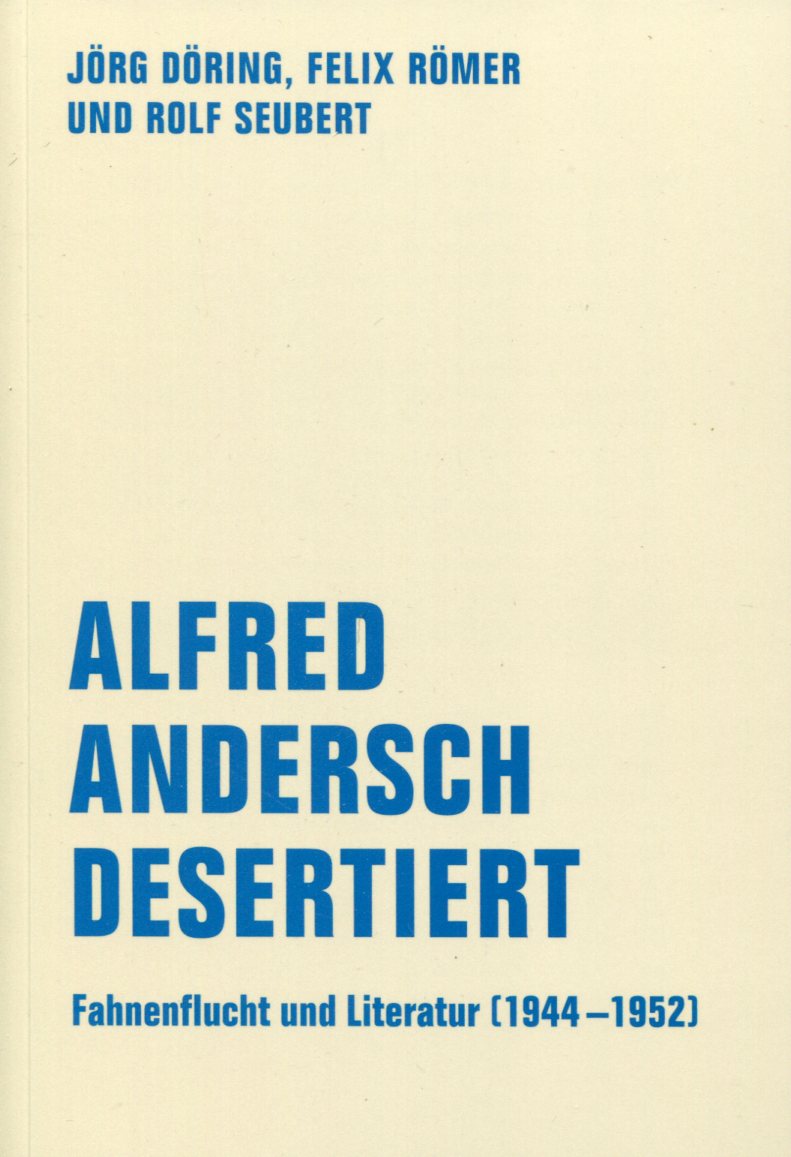
Alfred Andersch ist Westdeutschlands berühmtester Deserteur. Sein autobiografischer Bericht „Die Kirschen der Freiheit“ (1952) beschreibt die Umstände seiner Fahnenflucht aus Hitlers Wehrmacht am 6. Juni 1944 in Italien. Aber war er überhaupt ein Deserteur? Seit in seinem Nachlass ein Text auftauchte, den Andersch schon 1945 im Kriegsgefangenenlager geschrieben hatte und in dem die Gefangennahme gar nicht als Desertion geschildert wird („Amerikaner – Erster Eindruck“), sind Zweifel daran laut geworden, ob Andersch zu Recht in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin als Deserteur geehrt wird. Niemals bislang ist der Versuch unternommen worden, Anderschs Selbstbeschreibung anhand militärhistorischer Quellen zu überprüfen. Das vorliegende Buch versammelt diese Dokumente und erzählt eine in Teilen andere Geschichte: „Die Kirschen der Freiheit“ im Lichte der Akten. Eine Geschichte vom Überleben im Krieg, vom Heldenmut der Kampfesmüden und von den literarischen Verfahren der Selbstkonstruktion eines Autors. Auch als E-Book in allen einschlägigen Stores erhältlich. Inhaltsverzeichnis: 1. EINLEITUNG: War Alfred Andersch ein Deserteur? Und warum man das fragen darf2. Als Radfahrsoldat auf dem RückzugAndersch auf dem italienischen Kriegsschauplatz 19443. »Ich hatte mich entschlossen, rüber zu gehen«Anderschs 6. / 7. Juni 1944 im Lichte der Akten4. »Beim Absetzen zurückgeblieben«Eine Verlustliste der 3. Kompanie des Luftwaffen-Jäger-Regimentes 395. EXKURS: Deserteur oder nicht? Routinen der Gefangenenbefragung in der 5th US Army6. Anderschs militärisches Umfeld Gruppenkultur und Stimmung in der 20. Luftwaffen-Feld-Division7. Schreibanlassforschung oder Stationen der Autofiktion I»Amerikaner – Erster Eindruck«8. Stationen der Autofiktion II »Flucht in Etrurien« (1950)9. Stationen der Autofiktion III »Die Kirschen der Freiheit« (1952) in der Konkurrenz zu Hans Werner Richters »Die Geschlagenen« (1949)10. Deserteure in der westdeutschen Nachkriegsliteratur11. Der Diskurs über die Deserteure in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft12. SCHLUSS: Werk – Autor – DiskursAnmerkungenQuellen- und LiteraturverzeichnisDank

Georg Lukács’ „Geschichte und Klassenbewusstsein“ ist ein Werk mit einer geradezu überzeitlichen Wirkung. Als Reaktion auf das Scheitern der deterministisch antizipierten proletarischen Weltrevolution nach dem Ersten Weltkrieg erschien diese Sammlung von Essays und Aufsätzen erstmals 1923.Das Buch war aufgrund seiner scharfen Kritik am ‚orthodoxen Marxismus’ für die Herausbildung des sogenannten westlichen Marxismus von zentraler Bedeutung, auch wenn Lukács es nach Kritik und Anfeindungen seitens des parteioffiziellen Marxismus widerrief. Eine emanzipatorische Linke rezipierte Lukács immer wieder, besonders wurde er 1968 wieder ins Gedächtnis gerufen. Die von ihm verwendeten Begriffe von Dialektik, Verdinglichung, Entfremdung und Totalität bieten Gelegenheit, die Notwendigkeit der Abschaffung der bestehenden Verhältnisse mit philosophisch geschliffener theoretischer Schärfe zu begründen.Nach dem katastrophischen 20. Jahrhundert stellt dieses Buch die Frage nach der Aktualität von „Geschichte und Klassenbewusstsein“. Die Relevanz der genannten Begriffe wird hier betont, statt – wie im postmodernen Diskurs – kleingeredet. Die Beiträge des Bandes bewegen sich zwischen den Spannungspolen von Bewusstsein und Ideologie sowie Historizität und Geschichte.Mit Beiträgen von Àgnes Heller, Detlev Claussen, Rüdiger Dannemann, Frank Engster, Patrick Eiden-Offe, Roger Behrens, Stefan Müller, Johannes Rein, Veith Selk und Bastian Bredtmann, herausgegeben von Hanno Plass. Inhalt: Ágnes Heller: Vorwort Frank Engster: Lukács’ Existenzialismus oder Die Selbstreflexion der Produktivkraft durch das Selbstbewusstsein der Ware Arbeitskraft Patrick Eiden-Offe: Kampf-Form. Versuch über die Form der Partei bei Georg Lukács Rüdiger Dannemann: Das unabgeschlossene Projekt der Verdinglichungskritik – Verdinglichung als Leitbegriff der Gegenwartsdiagnostik Detlev Claussen: Geschichte ohne Klassenbewusstsein. Georg Lukács’ kurzes 20. Jahrhundert Roger Behrens: Konkrete Totalität Veith Selk: Demokratie und Verdinglichung Stefan Müller, Johannes Rhein: Totalität, Vermittlung und Unmittelbarkeit. Kategorien materialistischer Dialektik bei Georg Lukács und Theodor W. Adorno Bastian Bredtmann: Westlicher Marxismus und kritische Theorie Hanno Plass: Nachwort Dank Beitragende

Der Band versammelt Texte zur 68er-Revolte aus drei Jahrzehnten, in denen sich Agnoli oft kritisch, jedoch nie distanzierend dem Gegenstand seiner Betrachtung nähert – denn, wer «mitgemacht, mitgetragen, mitgenossen hat und nicht nur in der Form der Sympathie dabei war, sieht keinen Grund, sich von ihr zu distanzieren».Gemäß seiner italienischen Herkunft hat er auch die Entwicklungen in Italien im Auge und setzt sich sowohl mit dem «Deutschen Herbst» als auch mit dem «Italienischen Winter» auseinander.Er beschreibt dabei Brüche und Wendepunkte der außerparlamentarischen Rebellion und sagt schon früh den kommenden Weg der Grünen voraus, der seiner Meinung nach dorthin führen würde, wo sie heute angekommen sind: tief verwurzelt im Parlamentarismus und treu ergeben dessen Erfordernissen.

Heute sind die Doppelfahnen der »Antifaschistischen Aktion« das am häufigsten genutzte Symbol der linken Szene. Auch unter »Antifa« kann sich wohl jede_r etwas vorstellen. Schwarzer Block gleich Antifa; so vermitteln es zumindest die Medien in falscher Verkürzung. Denn die Geschichte dieser Bewegung reicht weit zurück und ist keineswegs auf Militanz zu reduzieren.Antifaschismus wurde in Deutschland Anfang der 1920er Jahre als polemischer Kampfbegriff durch die KPD eingeführt. Verstanden wurde darunter Antikapitalismus. Erst Anfang der 1930er Jahre rückte der Kampf gegen die Nationalsozialisten mehr und mehr in den Fokus. 1932 mündete diese Entwicklung in der Gründung der Antifaschistischen Aktion.In der BRD griffen kommunistische Gruppen in den 1970er Jahren das Emblem wieder auf. Später, von Autonomen übernommen und neu gestaltet, wurde es zum Zeichen der heutigen Antifa. Undogmatisch, radikal und systemkritisch ist Antifaschismus also von jeher viel mehr als nur ein Kampf gegen Nazis.Dieses Buch liefert den ersten umfassenden Überblick über die Entwicklung der Antifa. Ein Grundlagenwerk für Aktivist_innen und all diejenigen, die erfahren wollen, in welcher Tradition Antifaschismus in Deutschland steht. 2. aktualisierte und erweiterte Auflage
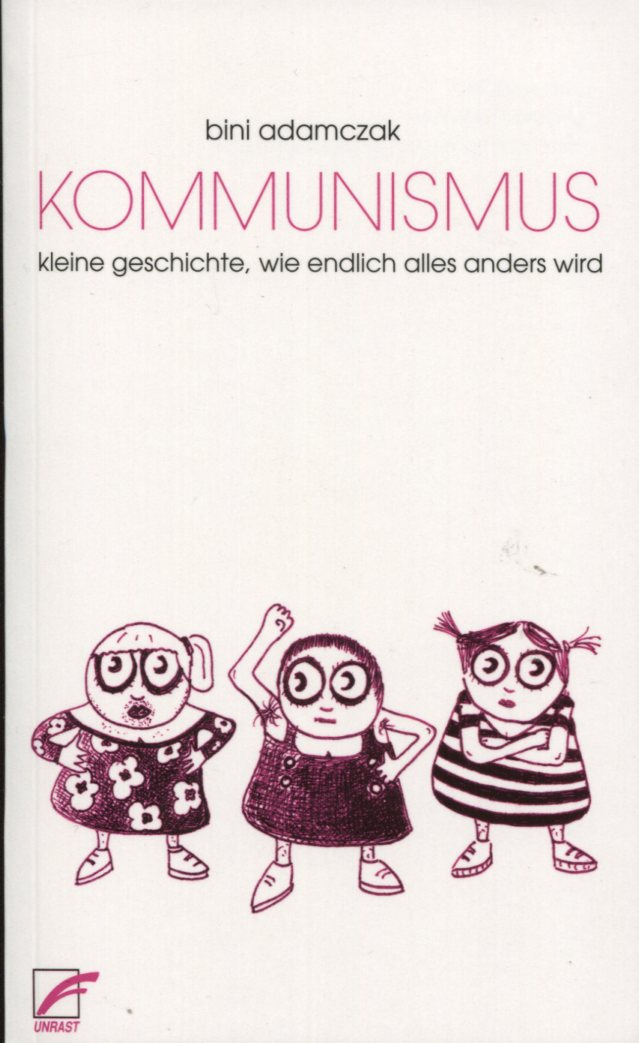
3. leicht überarbeitete Auflage Die dazugehörigen Postkarten findet ihr hier ... Zur Jubiläumsausgabe ... "schlaues Büchlein" ver.di publikWie lässt es sich – jetzt! – fünfzehn Jahre nach dem Ende der Geschichte über das Ende der Vorgeschichte, über Kommunismus schreiben, ohne der Lächerlichkeit eines ohnmächtigen Pathos zu verfallen? Kritische Kritik + Negation der Negation? Aber: sollte sich der Kommunismus auf übelgelaunte Negation beschränken, ohne Traum und Sexappeal? Es bedarf einer kinderleichten Sprache um ein kommunistisches Begehren zu erfinden. »Den Kommunismus machen: das kann ja wohl nicht so schwer sein.« KOMMUNISMUS ist für alle da. Einsteigerinnen und solche, die schon immer an diesem verflixten Fetischkapitel verzweifelt sind: Artisten der Negation, praktische Kritikerinnen und jene, denen das falsche Ganze einfach als zu farblos erscheint. Die kleine Geschichte erweist den Kommunismus gänzlich unzeitgemäß als das wunderlich Einfache + Schöne. Sie folgt einem kommunistischen Begehren: dass endlich alles anders wird. In ihrem Nachwort skizziert die Autorin die historischen und theoretischen Koordinaten der Konstruktion eines kommunistischen Begehrens. "In Missachtung der gängigen Genres ist Adamczak eine differenzierte Vergegenwärtigung der Fallstricke kommunistischer Gesellschaftskritik gelungen - mit Unterhaltungswert." Gottfried Oy, Frankfurter Rundschau "Das ist hübsch, aber auch mehr als das. Weil es beim Kommunismus nicht um die wahre Lehre, sondern auch um eine Lust zum Kommunismus geht. Etwa am Schreiben und Lesen." can Frankfurt Journal 20/04 "Sie begeht nicht den Fehler von Negri/Hardt, dass sie einen Liebeskommunismus à la Franz von Assisi entwirft, der den bürgerlich-linken Intellektuellen eine Träne im Knopfloch abfordert, sie macht etwas viel Radikaleres: Sie beschreibt lediglich den Weg zum Kommunismus, nicht das Ziel, und das in einer einfachen, einer kinderleichten Sprache. (…) Das kluge Nachwort, das man gern liest, beruhigt zudem alle, die sich vor ganz einfachen Texten ganz doll fürchten.“ Jörg Sundermeier, intro "... Der_die Leser_in lernt mit ihnen und merkt: Der Kommunismus muss gar kein kompliziertes, unverständliches Theorie-Ungetüm sein. Mensch kann ihn ganz einfach verstehen und siehe da: Es kann sogar Spaß machen!" Lesetipp strassenauszucker.blogsport.deReview in English The thought is captivating through its simplicity. To attempt to think about communism more than a decade after the “end of history” makes completely new ways of expression necessary. Far from the pathos of red flags or barricades, far from the pompousness of socialist parties and far from Marx exegesis. According to Bini Adamczak nowadays only a children’s language allows a free association of individuals to be thinkable and desirable again. “The Little Story, How Everything Will Finally Change” is a theoretical story told in the language of a children’s book. With this it falls through every grid, not being really a children's book, or a theoretical essay, nor a literary tale or a historical abstract. In contempt of current genres Adamczak presents the many traps in which a communist critique may get caught in – with entertainment factor. From feudalism until today: Adamczak writes about jealous princesses, chandlers, glass pearls that are exchanged for gold, displaced farmers, who have to sell their (wo)manpower in the town, about flat-iron-factories and “the big saucepan”, the state, into which all throw their money in the hope that it will be distributed justly. The competition of the factories leads to a general crisis and this becomes the centre of the story. “And that's how it’s done”: in six attempts the men and women in the flat-iron-factories try out the historic models of socialist/communist change, but have to realize quickly that they are still unhappy. Whether it is the regulation of the market or complete socialization, the self organization of labour or its abolishment in the eyes of the humans something essential always remains unconsidered: stupid work, competition, beauraucracy, reification or the backslide behind already reached standards of life. “Attempt number 6”, the conscious decision to take everything into their own hands finally leads to a radical turn: “We will decide for ourselves, how it will continue."
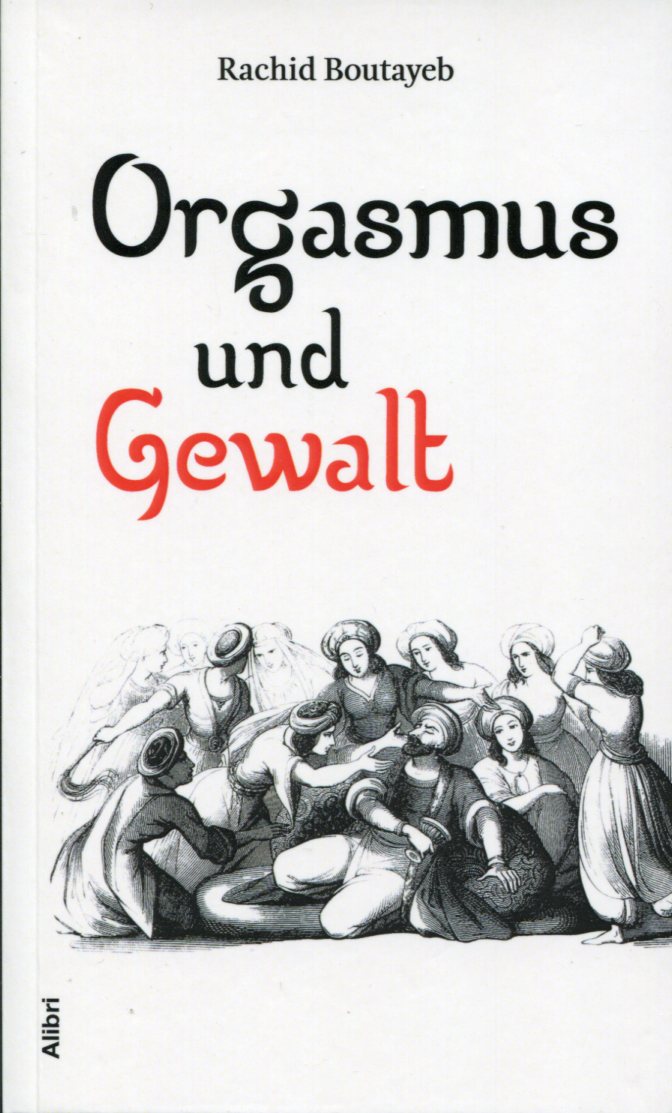
In seinen Texten befasst sich Rachid Boutayeb mit dem Körper im Islam. Es geht darin nicht nur um den „phallozentrischen Diskurs der Orthodoxie“ und die Gewalt gegen die Weiblichkeit, sondern auch um tieferliegende Fragen der Autonomie des Körpers. Dabei bringt Boutayeb vor allem die dissidenten Stimmen des Maghreb gegen die Orthodoxie in Stellung.
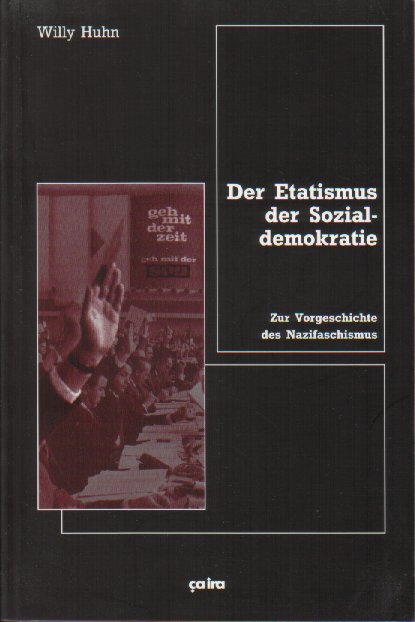
Der Essay von Willy Huhn gehört zu den Klassikern einer linken, nicht parteikommunistischen Kritik der offiziellen, sozialdemokratischen Arbeiterbewegung. Huhn stellt ideologiekritisch dar, wie es zur Staatsfixierung und am Ende zur Verstaatlichung der SPD kommen konnte. Er untersucht die Staatsphilosophie Ferdinand Lassalles, des Begründers der Sozialdemokratie, stellt dar, inwieweit Karl Kautsky die Marxsche Staatskritik im Streit um die Verstaatlichung der Schlüsselindustrien mißverstand, und greift die These holländischer Rätekommunisten auf, die die Sozialdemokratie als prinzipiell obrigkeitshörige und staatssozialistische Partei begriffen. Damit bewegt sich Huhn an den Wurzeln der heutigen Sozialdemokratie der “Volks-Partei” des Godesberger Programms und zeigt auf, daß sich alle über die Möglichkeiten der SPD, Real- und Reformpolitik treiben zu können, gründlich irren – auch in der Berliner Republik. Mit einem Vorwort von Clemens Nachtmann und einem biographischen Exkurs von Christian Riechers Der Autor: Willy Huhn gehörte in der Weimarer Republik zu den Rätekommunisten der “Roten Kämpfer”, eine der aktivsten Organisationen im Widerstand gegen Hitler. Nach 1945 lehrte er an der Berliner Volkshochschule und war Redakteur der Zeitschrift “pro und contra”, die er bis zum Bruch mit dem Trotzkismus gemeinsam mit Ernest Mandel herausgab. Ausschluß aus der SPD 1953, u.a. wegen des öffentlich geführten Nachweises, “daß die sozialdemokratische Regierung Ebert, Scheidemann, Noske bewußt auf die Abschlachtung der revolutionären Arbeiter hingearbeitet hätte.” Die Herausgeber: Clemens Nachtmann (Berlin) ist Redakteur der Zeitschrift “Bahamas”, Christian Riechers war Professor für Politikwissenschaft in Hannover. Inhaltsverzeichnis und Leseproben CLEMENS NACHTMANNDie deutsche Sozialdemokratie als Partei des “Nationalsozialismus”.Willy Huhns Überlegungen zum totalen Staat WILLY HUHNEtatismus – “Kriegssozialismus” – “Nationalsozialismus” in der Literatur der deutschen Sozialdemokratie- Die Lassalle-Legende- Der Streit um den Staatssozialismus- Vom Sozialistengesetz zum Kriegssozialismus- Die Ideen von 1914 und die Folgen- AnmerkungenWILLY HUHNBilanz nach zehn Jahren (1929–1939)A. Die Periode der geistigen Rezeptivität (1929–1932)B. Die Periode der theoretischen Produktivität (1932–1939)1. Historische Kritik der Sozialdemokratie2. Historische Kritik des Staatssozialismus3. Historische Kritik der Kriegswirtschaft4. Historische Kritik des Bolschewismus5. Kritik des Faschismus6. Die historische Notwendigkeit des Nationalsozialismus7. Die Kriegswirtschaft als ökonomisches Problem8. Historische Kritik des NaturalismusWILLY HUHNKarl Marx gegen den StalinismusWas Marx und Engels unter “Kommunismus” verstanden CHRISTIAN RIECHERSWilly Huhn (1909 - 1970)Eine biographische Notiz JOACHIM BRUHNAvantgarde und IdeologieNachbemerkung zum RätekommunismusAnhang RALF WALTERWilly Huhn: Eine bibliographische Information

Alex Gruber, Philipp Lenhard (Hg.): Gegenaufklärung - Der postmoderne Beitrag zur Barbarisierung der Gesellschaft, ISBN 978-3-86259-101-5 Die postmoderne Philosophie ist nichts anderes als “das Nachleben des Nationalsozialismus in der Demokratie” (Adorno). Weil der radikale Bruch mit dem Denken, das zu Auschwitz führte, ausblieb, weil vielmehr bereits in den sechziger Jahren gerade von links in vermeintlich tabubrecherischer Weise versucht wurde, die nationalsozialistische Philosophie für scheinbar “emanzipatorische” Projekte nutzbar zu machen, erscheint die deutsche Ideologie heute als links und progressiv. Diese neueste deutsche Ideologie ist nicht nur eine philosophische Strömung, sondern Ausdruck einer gesellschaftlichen Tendenz. Die postmoderne Übung, jede allgemeine Begriffsbestimmung als “logozentrisch” und jede Betrachtung der Gesellschaft unter Vernunftkriterien als totalitär zu denunzieren, ist sowohl Reflex der objektiven Unbrauchbarkeit der Welt unter den Verhältnissen spätkapitalistischer Vergesellschaftung als auch der Versuch einer Sinnstiftung ebendieser Verhältnisse. In seinem Kult der Unmittelbarkeit schließlich sucht der Poststrukturalismus den Schulterschluß mit dem radikalen Islam und verrät jede Idee von Versöhnung. Mit Beiträgen von Manfred Dahlmann, Martin Dornis, Alex Gruber, Birte Hewera, Tjark Kunstreich, Philipp Lenhard, Niklaas Machunsky, Florian Ruttner und Gerhard Scheit. Inhalt Alex Gruber/Philipp Lenhard: “Deutsche Ideologie”: Von Stirner zum PoststrukturalismusEinleitung zum vorliegenden Sammelband Tjark Kunstreich: Dem dunklen Gott geopfertLacans Erledigung des Selbstwiderspruchs des Subjekts Gerhard Scheit: Altern der Musik, Verjüngung des StrukturalismusÜber die Vorgeschichte der Postmoderne Birte Hewera: “Das System ist alles. Der Mensch ist nichts. Die Wirklichkeit ist - wenig“. Jean Améry und der Strukturalismus. Florian Ruttner: Der Mythos des RadikalenDer Verrat an der Aufklärung bei Georges Sorel, Georges Bataille und Michel Foucault Martin Dornis: Der Meister aus DeutschlandZur Kritik der Ideologie des Todes Alex Gruber: Dekonstruktion und RegressionDer Poststrukturalismus als Masseverwalter von Carl Schmitt und Martin Heidegger Philipp Lenhard: Negativer UniversalismusGiorgio Agamben, Étienne Balibar und der Zusammenhang von Antirassismus und Israelhass Niklaas Machunsky: Politik gegen das Politische, Arbeiter gegen IsraelAlain Badiou und der Universalismus Manfred Dahlmann: Biedermann und ÜbermenschPeter Sloterdijks deutsche Ideologie Philipp Lenhard: Sein zum TodeHeidegger, Qutb und die Aktualität der deutschen Ideologie Literaturverzeichnis

KLASSENKAMPFSPIELE Texte von Richard Barbrook, Mark Copplestone, Fabian Tompsett und Alex VenessFilm von Ilze Black Herausgegeben, übersetzt und eingeleitet von Stefan Lutschinger 2014 Unpopular Books Poplar
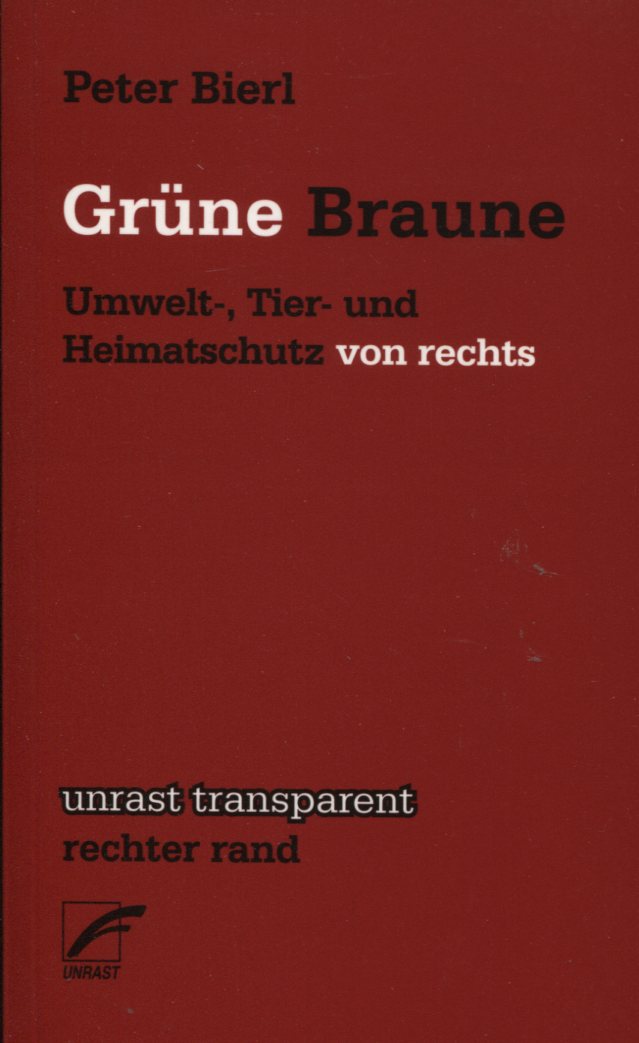
unrast transparent - rechter rand Bd. 5 Seit Jahren versuchen militante Neonazis und rechte Ideologen mit ökologischen Themen zu punkten. Die NPD protestiert gegen Gentechnik, Kameradschaften demonstrieren gegen Castor-Transporte und Autonome Nationalisten gegen Schweinemastbetriebe und für Vegetarismus. In Umwelt & Aktiv warnen Autoren vor zerstörerischer Wachstumspolitik und beklagen einen Raubbau an der Natur. Werden rechte Ökobauern enttarnt, löst deren Engagement immer wieder Überraschung aus. Bürgerinitiativen zeigen sich verwundet, wenn extrem Rechte mitmischen.Dabei haben Nazis immer schon gesellschaftliche Widersprüche aufgegriffen und gemäß ihrer Weltanschauung interpretiert, um neue Anhänger_innen zu rekrutieren. Das gilt für die soziale Frage, die Frauenbewegung wie für Ökologie. Zumal Umweltschutz traditionell ein Thema der Rechten ist. »Es ist vollkommen falsch, und hierin liegt ein großer Verdienst Bierls, Ökologie von rechts intellektuell zu unterschätzen.« Stefan Gleser, Saarkurier Online, 23. April 2014Die Lebensreformer und Heimatschützer des Kaiserreichs und der Weimarer Republik waren überwiegend konservativ bis völkisch-antisemitisch. Ideen und Personen aus diesem Spektrum prägten noch die moderne Ökologiebewegung und die Gründungsphase der Grünen. Die Biozentristen und Tiefenökologen, die sich im Umfeld von Protestbewegungen der 1970er Jahre entwickelten, verbinden Esoterik mit prinzipieller Menschenfeindlichkeit. Sie agitieren gegen Einwanderung und eine angebliche Überbevölkerung. Parolen der Neuen Rechten gegen Homogenisierung, für kulturelle Differenz und ein Recht auf Heimat sind längst in linke und ökologische Diskurse eingegangen.
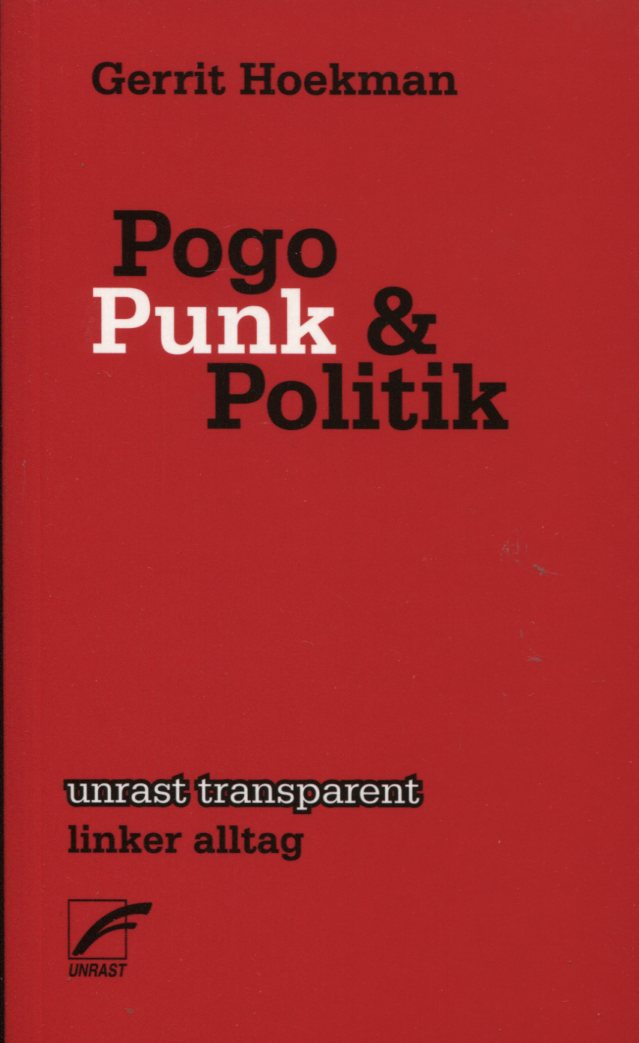
ransparent - linker alltag - band 2 Eine kleine Geschichte des Politpunk Punk und Politik – für manche ist das ein Widerspruch in sich. Punk ist ein Lebensgefühl, das nicht nach morgen fragt und alle gültigen Konventionen sprengt."Auf 70 Seiten lässt sich das Punkuniversum nur grob anreißen. Und genau das macht Gerrit Hoekman im Stil eines flott gespielten Punk-Songs." Florian Schmid in 'der Freitag' No Future, gegen alles und für nichts, sich trauen, was sich sonst niemand traut. Viele der frühen Punkbands in den Siebzigern lebten diesen Nihilismus, allen voran die legendären Sex Pistols. Trotz Anarchy in the UK und God save the Queen war ihr politischer Hintergrund, wenn überhaupt, bescheiden. Provokation um der Provokation willen. Doch schon früh entstanden Bands, die sich nicht nur als Schocktherapie für die bürgerliche Gesellschaft verstanden, sondern anprangern und verändern wollten. Von ihnen handelt dieses Buch..
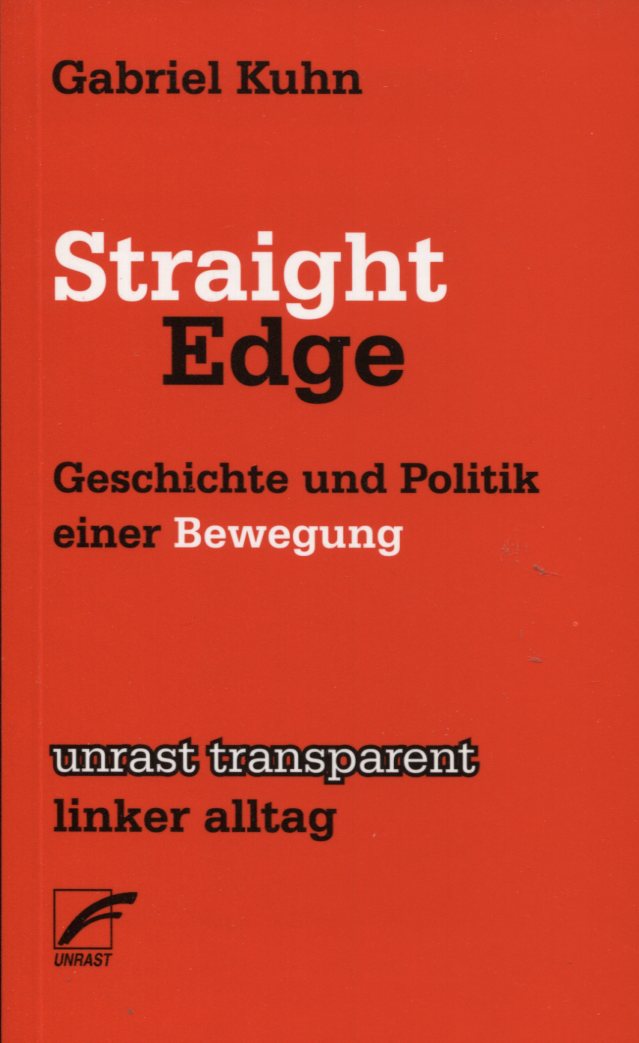
transparent - linker alltag - band 1 Eine Analyse drogenfreier Hardcore-Punk-Kultur. Straight Edge entstand Anfang der 1980er Jahre als eine drogenfreie Subkultur innerhalb der Hardcore-Punk-Szene. Bald entwickelte sich daraus eine Bewegung, die sich auf alle Kontinente ausdehnte."...ich kann Euch sagen, das kleine Büchlein hat es in sich." 'dolf' auf trust-zine.de 1981 schrieb Ian MacKaye, damals Sänger der Washington-DC-Hardcore-Band Minor Threat, den Song "Straight Edge", um seinen Verzicht auf Alkohol-, Nikotin- und Drogenkonsum innerhalb der Hardcore-Punk-Szene zu verteidigen. Er initiierte damit – gegen seine ausdrücklichen Intentionen – eine Bewegung, die bis heute eine fixe Größe in der Welt des Hardcore-Punk darstellt. Dieses Buch zeichnet die Geschichte der Straight-Edge-Bewegung nach, von den Anfängen in Washington, DC, über die sogenannten Youth-Crew-Bands der späten 80er Jahre und die Vegan-Straight-Edge-Bewegung der 90er bis hin zu der vielfältigen Straight-Edge-Kultur der Gegenwart. Ein besonderes Augenmerk wird dabei auf die ambivalenten politischen Dimensionen der Bewegung gelegt, die seit jeher zwischen konservativem Puritanismus und linksradikalem Aktivismus pendeln. Analysiert werden dabei unter anderem die Rolle von Geschlecht, Sexualität, Kapitalismus/Konsumkultur, Tierrechten, Naturschutz und Religion innerhalb der Straight-Edge-Szene. "Das gerade mal 70 Seiten starke Büchlein liest sich spannend und flüssig."Anna Hölscher, philtrat nr. 100 - April 2011 »Auf bloss 72 Seiten können keine Details erwartet werden. Doch Kuhn gelingt eine kurzweilige Einführung in eine facettenreiche Jugend-bewegung, die den ›rebellischen Charakter des Punk‹ aufrecht erhält.« Tobias Sennhauser, tier-im-fokus.ch, 09.05.2014Vegan Straight Edge: Lifestyle oder Ideologie? von Klaus Petrus

Mit einem Vorwort von Volin (1923) Übersetzung aus dem Russischen von Walter Hold Klassiker der Sozialrevolte Bd. 1 2. unveränderte AuflageZwischen 1917 und 1922 organisierte sich während der Russischen Revolution eine eigenständige autonome Volksbewegung in der Ukraine – die Machnowstschina. Ihr gelang es, trotz ständiger Angriffe von Seiten der konterrevolutionären Generäle Denikin und Wrangel, unter der Führung von Nestor Machno ein Gemeinwesen aufzubauen, das vier Jahre lang ohne Parteien, Ausbeutung und Unterdrückung funktionierte, bis die Rote Armee unter Trotzki die freien Kommunen und Agrarkollektive niederschlug. Peter A. Arschinoff (1887-1937), erlernte den Beruf des Schlossers. Als Fabrikarbeiter kommt er etwa 1904 in Kontakt mit revolutionären Kreisen und wird zuerst Sozialdemokrat (Bolschewik); schon bald schreibt er auch Artikel für die illegale Arbeiterpresse. 1906 wird er (kommunistischer) Anarchist. Neben der rein agitatorischen Arbeit nimmt er kurze Zeit später an terroristischen Aktionen teil. Im Butyrki-Gefängnis in Moskau lernt er 1910 Machno kennen; sie freunden sich schnell an und Arschinoff unterrichtet Machno in »anarchistischer Theorie«. Zusammen werden sie im März 1917 nach der Februar-Revolution durch eine Amnestie der provisorischen Regierung befreit.
